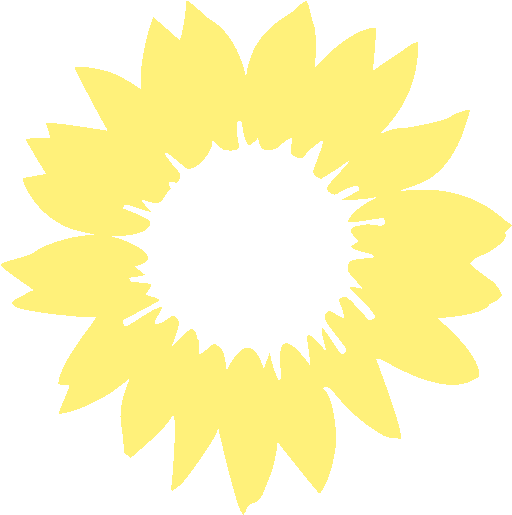In Hamburg untersucht ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Was ist Cum-Ex überhaupt? Was macht ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss? Und wie ist der aktuelle Stand der Untersuchungen? Hier findet ihr alle wichtigen Fragen, Antworten und Hintergründe zum Thema.
Was ist Cum-Ex?
Die auf Aktiendividenden fällige Kapitalertragssteuer wird bei der Dividendenauszahlung normalerweise automatisch an das Finanzamt abgeführt, ist aber für institutionelle Anleger (z.B. Firmen oder Banken) anschließend erstattungsfähig. Natürlich wird pro Aktie nur einmal Dividende ausgeschüttet und dementsprechend auch nur einmal die entsprechende Steuer abgeführt.
Bei sogenannten Cum-Ex-Geschäften handelt es sich um kurzfristige Leerverkäufe (Leihgeschäfte) mit mehreren Beteiligten. Auf diese Weise wurde dem Finanzamt vorgetäuscht, es hätte zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung für eine Aktie mehrere Eigentümer gleichzeitig gegeben. Diese vermeintlichen Eigentümer erhoben im Anschluss unberechtigterweise mehrfach Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragssteuer.
Cum-Ex-Geschäfte sind also schwerste Steuerhinterziehung und somit Betrug an der Gesellschaft. Spätestens seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2021 ist klar, dass diese mit hoher krimineller Energie erdachten Finanzkonstruktionen illegal sind und auch nie legal gewesen sein konnten. Sie gehören auf allen Ebenen verfolgt und geahndet.
Der Fall Warburg und die Vorwürfe der politischen Einflussnahme
Cum-Ex ist keine Erfindung aus Hamburg, sondern fand über Jahrzehnte hinweg in ganz Deutschland und Europa statt. Zunächst waren Cum-Ex-Geschäfte nur zwischen Finanzinstitutionen möglich (s.g. Interbankengeschäft). Später wurden sie als Finanzprodukt auch privaten Investoren angeboten (über s.g. Publikumsfonds).
Die Hamburger Privatbank M.M.Warburg, die im Zusammenhang mit Cum-Ex traurige Berühmtheit auch über die Stadtgrenzen hinaus erlangt hat, beteiligte sich mutmaßlich an beiden Geschäftsmodellen. Sie soll also sowohl eigenes Geld als auch das Geld ihrer Kund*innen in Cum-Ex-Deals (s.o.) investiert haben.
Anfang 2016 durchsucht die Kölner Staatsanwaltschaft aufgrund entsprechender Hinweise die Geschäftsräume der Warburg-Bank. Alarmiert von diesen staatsanwaltlichen Ermittlungen beginnt nun auch das Hamburger Finanzamt in der Folge ausführlich den Steuerfall Warburg zu prüfen und kommt im Oktober 2016 zunächst zu der internen Auffassung, rund 47 Mio. € von der Bank zurückfordern zu können. Einen Monat darauf revidieren Finanzamt und Finanzbehörde diese Entscheidung jedoch bei einem gemeinsamen Spitzentreffen. Später wurde bekannt, dass zur selben Zeit – also kurz vor der Entscheidung zugunsten Warburgs – zwei Treffen sowie ein Telefonat zwischen dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Warburg-Miteigentümer Christian Olearius stattgefunden haben. Außerdem hatte der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) ein Argumentationspapier in seine Behörde weitergeleitet, obwohl dieses dort bereits erkennbar vorlag. In der Folge wurden Vorwürfe laut, der Hamburger Senat hätte auf die Steuerangelegenheit Einfluss genommen, um die Bank zu schonen.
Als weitere Indizien für diese Vorwürfe werden auch die sich anschließenden Entwicklungen der Folgejahre angeführt: Im Herbst 2017 bspw. gilt der Sachverhalt trotz umfangreicher Gutachten u.a. weiterhin als nicht ausermittelt. Außerdem findet ein mittlerweile drittes Treffen zwischen Scholz und Olearius zu dieser Angelegenheit statt. Das Finanzamt möchte in der Folge keine Rückforderung von weiteren rund 43 Mio. € veranlassen und muss sich nun sogar beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) hierfür rechtfertigen. Da das Hamburger Finanzamt bei seiner Auffassung bleibt, erlässt das BMF schließlich Ende 2017 eine Weisung, das Geld von der Bank zurückzufordern.
Die zeitliche Nähe der oben dargestellten Ereignisse begründen für sich genommen erstmal noch keinen kausalen Zusammenhang. Sie werfen allerdings Fragen auf, die es aufzuarbeiten gilt. Wir Hamburger Grüne setzen uns hierbei für eine sachliche, objektive und vollständige Aufklärung der erhobenen Vorwürfe ein. Daher haben wir von Beginn an die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) mit unterstützt.
Einsetzungsanträge: Drucksachen 22/1762 und 22/1924
Was macht eigentlich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschusses (PUA)?
Ein PUA ist eines der wichtigsten Kontrollinstrumente der Bürgerschaft gegenüber dem Senat. Für die Einsetzung genügt bereits die Zustimmung von einem Fünftel der Parlamentarier*innen, also 25 der 123 Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft.
Die Mitglieder haben starke Befugnisse, denn die Regeln des PUA orientieren sich an der Strafprozessordnung: Zeugen müssen vor dem Ausschuss erscheinen und dürfen nur in Ausnahmefällen die Aussage verweigern. Außerdem darf ein PUA Akteneinsicht verlangen und Sachverständige anhören.
Gesetz über die Untersuchungsausschüsse der Hamburgischen Bürgerschaft
Der aktuelle PUA setzt sich zusammen aus 12 Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft und noch mal derselben Anzahl stellvertretender Mitglieder. Wir als Grüne Fraktion sind mit drei ordentlichen und drei stellvertretenden Mitgliedern vertreten. Außerdem wird der PUA auf fachlicher Ebene unterstützt von einem Arbeitsstab, der dem Ausschuss und seinen Mitgliedern unabhängige Expertise aus unterschiedlichen Fachrichtungen zur Verfügung stellt. Dort werden die Ausschusssitzungen organisatorisch und inhaltlich vorbereitet, Fragenkataloge entworfen, Stellungnahmen und Protokolle verfasst, Akten ausgewertet und letztlich auch die Zwischen- bzw. Abschlussberichte entwickelt.
Wie ist der Stand der Untersuchungen im Fall Warburg?
Seit den Enthüllungen rund um Cum-Ex im Allgemeinen und Warburg im Besonderen ist viel geschehen. Große mediale Aufmerksamkeit, über einhundert Ermittlungs- und Strafverfahren, teilweise bereits rechtskräftig mit langen Haftstrafen abgeschlossen, ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Bundestag und seit November 2020 auch in Hamburg: der PUA „Cum-Ex Steuergeldaffäre“.
In den vergangen knapp drei Jahren konnte dieser Hamburger PUA tausende Seiten Akten (Steuerunterlagen, Gutachten, Vermerke, Mails, Kalenderdaten, etc.) sichten, mehr als 70 Zeug*innen (viele davon über mehrere Stunden) vernehmen und Sachverständige anhören, um dem Vorwurf der politischen Einflussnahme laut Untersuchungsauftrag nachzugehen.
Der PUA hat der Hamburgischen Bürgerschaft im Februar 2024 einen über 1000 Seiten umfassenden Zwischenbericht zu den gesammelten Erkenntnissen im sogenannten „Fall Warburg” vorgelegt [Drucksache 22/14500]. Dieser umfasst neben der Sachverhaltsaufbereitung auch eine per Mehrheitsbeschluss gefasste offizielle Bewertung sowie die Minderheitsberichte der Oppositionsfraktionen.
Die Beweiserhebung ist damit aber noch nicht abgeschlossen – auch weil weiterhin offene Fragen bleiben. Hier ein paar Beispiele:
1. Die Kontakte zwischen Olaf Scholz und Christian Olearius
Warum hat sich der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) mehrfach mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius in einer Steuerangelegenheit getroffen, von der zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass sie Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen war? Warum gab Scholz dem Bankier anschließend noch einen telefonischen Rat?
Hintergrund: Vor dem Untersuchungsausschuss wurde hierzu wiederholt auf die übliche Kontaktpflege zwischen Politik und Wirtschaft verwiesen, in deren Zuge die Bank lediglich ihren Standpunkt darstellen wollte. Übliche Kontaktpflege zwischen Wirtschaft und Politik beinhaltet in der Regel jedoch nicht eine spezifische Steuerangelegenheit, die der Hamburger Steuerverwaltung wie in diesem Fall inkl. aller von Warburg vorgetragener Standpunkte bereits zur Prüfung vorlag. Scholz traf sich darüber hinaus gleich mehrfach innerhalb kurzer Zeit mit Olearius und erteilte ihm anschließend den telefonischen Rat, sein Argumentationspapier kommentarlos an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher zu schicken.
Im Rahmen seiner Zeugenvernehmung sagte Scholz aus, er habe Olearius mit diesem Anruf lediglich auf den üblichen Dienstweg verwiesen. Da das Anliegen inkl. Argumentationspapier bereits zur Prüfung in der Verwaltung vorlag, erscheint eine zusätzliche Eingabe über den Senator nicht nachvollziehbar – zumal die Finanzbehörde eigens für strittige Fälle eine Beschwerdestelle unterhält.
2. Der „teuflische Plan“
Was hat es mit dem „teuflischen Plan“ auf sich, wie die Finanzbeamtin P. die Vorgänge rund um die Entscheidung zugunsten Warburgs am 17.11.2016 gegenüber einer Arbeitskollegin in einem privaten Chat bezeichnete?
Hintergrund: Gegenüber dem PUA machte die Finanzbeamtin P. hierzu von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, da gegen sie mittlerweile ein Strafermittlungsverfahren läuft. In besagtem Chatverlauf wurden jedoch auch vorgesetzte Personen aus dem Finanzamt bzw. der Finanzbehörde mit erwähnt. Diese sowie weitere mit der Angelegenheit befassten Finanzbeamt*innen inkl. der Chatpartnerin wurden hierzu befragt. Dabei konnte keine Erklärung für die Formulierung „teuflischer Plan“ gefunden werden.
3. Die Weisung des Bundesfinanzministeriums
Wieso widersprach die Hamburger Finanzbehörde (in Abstimmung mit dem Hamburger Finanzamt) Ende 2017 einer Weisung des Bundesfinanzministeriums, die vorsah, die Cum-Ex-Millionen von Warburg endlich zurückzufordern?
Hintergrund: Die Verantwortlichen der Hamburger Finanzverwaltung bezogen sich in ihren Vernehmungen hierzu wiederholt auf die abstrakte Sorge einer sogenannten Amtshaftung (in Verbindung mit einem vermeintlich nicht ausermittelten Sachverhalt). Im Rahmen einer Amtshaftung müsste der Staat bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlentscheidungen seiner Verwaltung Schadensersatz an Dritte zahlen. Dieses Amtshaftungsrisiko hätte trotz der Weisung aus Berlin weiter bei Hamburg gelegen. Angesichts der bereits ergangenen Urteile zu ähnlich gelagerten Cum-Ex-Fällen und der Indizienlage gegenüber Warburg erscheint es jedoch nicht nachvollziehbar, warum diese Sorge so großes Gewicht bei den Warburg-Entscheidungen der Hamburger Finanzverwaltung hatte.
4. Das Bemühen um verringerte Rückzahlungen
Wieso setzte sich die Hamburger Finanzbehörde (in Abstimmung mit dem Hamburger Finanzamt) für eine sogenannte „Tatsächliche Verständigung“ mit der Warburg-Bank ein, nachdem das BMF an seiner Weisung festhielt?
Hintergrund: Bei einer Tatsächlichen Verständigung wäre nur ein Teil des Geldes, auf den sich beide Seiten geeinigt haben, zurückzuzahlen gewesen. Die Finanzverwaltung bemühte sich genau darum, obwohl parallel das Landgericht Bonn bereits angekündigt hatte, im Falle einer Verurteilung von Geschäftspartnern der Warburg-Bank die volle Summe von Warburg einzuziehen. Darauf weisen entsprechende Unterlagen und Mails hin, die im Rahmen des Untersuchungsausschusses gesichtet wurden.
5. Strukturelle Versäumnisse der Verwaltung
Über die oben genannten Punkte hinaus konnten Erkenntnisse gesammelt werden, die auf weitere strukturelle Probleme innerhalb der Finanz- und Steuerverwaltung hindeuten. Hier stellt sich die Frage, wie diesen Problemen zukünftig vorgebeugt werden soll und welche konkreten Maßnahmen sich daraus ableiten?
Hintergrund:
- Das Finanzamt hat u.a. die rechtliche Möglichkeit einer Beweislastumkehr nicht erkannt bzw. nicht von dieser Gebrauch gemacht. Stattdessen hat das Finanzamt weiter vergeblich versucht, kaum nachweisbare Lieferketten der Aktien zu ermitteln.
- Alle an den Entscheidungen im Fall Warburg beteiligten Beamt*innen der Hamburger Finanzverwaltung gingen damals davon aus, dass mit Ablauf der Jahre 2016 bzw. 2017 Zahlungsverjährung eintreten würde (und die damaligen Entscheidungen müssen auch weiterhin vor diesem Hintergrund bewertet werden). Diese Annahme erwies sich später allerdings als Fehleinschätzung der Verwaltung.
- Das thematisch für Cum-Ex-Geschäfte zuständige Referat 520 in der Finanzbehörde wurde Ende 2014 aus Haushaltsgründen aufgelöst. Hierdurch gingen Kapazitäten, aber auch Expertise zum Thema verloren. Weitere interne und externe Expertise (bspw. BZSt, Bund-Länder-Austausch) fand im weiteren Verlauf keine oder zu wenig Berücksichtigung.
- Die vermeintliche Existenzgefährdung, der sich Warburg angesichts der drohenden Rückzahlungen nach eigenen Angaben ausgesetzt sah, wurde von der Hamburger Finanzverwaltung bei zentralen Entscheidungen stets mitberücksichtigt – gleichzeitig aber wurde innerhalb der Verwaltung keine eigene Prüfung der wirtschaftlichen Situation der Bank veranlasst.
Festzuhalten ist: Die Unschuldsvermutung gilt selbstverständlich für alle Beschuldigten. Bisher konnten entsprechend des Untersuchungsauftrages des PUA „Cum-Ex Steuergeldaffäre“ keine Belege für eine unmittelbare politische Einflussnahme erbracht werden. Es bleiben aber weiterhin offene Fragen bestehen, die es zu beantworten gilt. In der Öffentlichkeit darf niemals der Eindruck entstehen, dass Missstände, etwa aufgrund parteipolitischer Erwägungen, nicht restlos aufgeklärt werden. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich derartiges in Zukunft wiederholt. Das gelingt nur durch eine vollständige Aufklärung bei größtmöglicher Transparenz und die Behebung aller genannten strukturellen Missstände innerhalb der Verwaltung. Genau dafür setzen wir uns als Grüne Fraktion auch weiterhin ein.
Wie geht es jetzt weiter?
Der nun vorliegende Zwischenbericht ist ein wichtiger Meilenstein, kann aber kein Zurücklehnen bedeuten.
Wir gehen daher auch deutlich über die reine Feststellung von Missständen und offenen Fragen hinaus und haben uns mit unserem Koalitionspartner auf konkrete Maßnahmen verständigt, wie die strukturellen Probleme behoben werden können und die Hamburger Finanzverwaltung zukünftig gestärkt wird. (Einzelheiten zu dieser gemeinsamen parlamentarischen Initiative sind bereits im Zwischenbericht des PUA festgehalten)
Darüber hinaus liegen dem PUA neue Akten auch zum Fall Warburg vor, die ausgewertet werden müssen und in die Beweiserhebung des PUA einfließen werden. Zudem laufen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen einzelne Akteur*innen in dieser Angelegenheit, aus denen sich weitere Erkenntnisse für den Hamburger PUA ergeben könnten.
Und schließlich werden die Untersuchungen, wie vor einem Jahr einstimmig in der Hamburgischen Bürgerschaft beschlossen [Drucksache 22/9009], ausgeweitet auf weitere Hamburger Banken (insbesondere die frühere HSH Nordbank), die tatsächlich oder mutmaßlich Cum-Ex-Geschäfte betrieben haben, sowie die Rolle der Politik in diesen Fällen. Erste Akten hierzu hat der Senat dem PUA bereits übermittelt. Weitere Zeug*innenvernehmungen sind im Rahmen dieser Erweiterung ebenfalls zu erwarten.
Update: Wie ist der Stand der Untersuchungen im Fall HSH?
Vorgeschichte zu den Vorwürfen im Fall HSH
Mit Verabschiedung des Zwischenberichts zum Fall Warburg im Februar 2024 konzentrierte sich die Arbeit des Untersuchungsausschusses “Cum-Ex” vorrangig auf die Cum-Ex-Geschäfte der HSH Nordbank (heute: Hamburg Commercial Bank, HCB), sowie die Rolle von Politik und Behörden bei der Aufarbeitung dieser Geschäfte. Seit April 2024 sind unzählige neue Akten durch den Untersuchungsausschuss gesichtet worden und bisher 26 Zeug*innen (11 weitere stehen noch aus) in dieser Angelegenheit befragt worden.
Eine Besonderheit hier besteht darin, dass es sich bei der HSH Nordbank um eine Landesbank handelte, die sich bis 2018 im geteilten Besitz der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein befand. Der Raubzug durch die Steuerkasse ging also vollständig zulasten der Öffentlichkeit und damit wiederum ihrer Eigentümer*innen. Hinzu kommen Verdachtsmomente hinsichtlich weiterer s.g. steuergetriebener Geschäftsmodelle (”Cum-Cum”, ”Nordic Tool”, “Nordic Hedge”), denen die Staatsanwaltschaft in Köln aktuell nachgeht.
Die kriminellen Geschäfte selbst fanden nach aktuellem Kenntnisstand hauptsächlich in den Jahren 2008 bis 2011 statt. Die steuerrechtliche Überprüfung im zuständigen Finanzamt hätte dann – wie bei Betriebsprüfungen üblich – erst einige Jahre später erfolgen sollen. Diesen Überprüfungen kam die HSH Nordbank allerdings zuvor, nachdem sie 2013 im Zuge einer sich verschärfenden Debatte rund um Cum-Ex-Geschäfte erkannte, dass sie möglicherweise selbst hieran mitgewirkt und von entsprechenden Erträgen profitiert hatte. Die Bank meldete ihren Verdacht dem Finanzamt, verbunden mit der Ankündigung, einer großen Wirtschaftskanzlei (CliffordChance) vollständigen Zugang zu allen relevanten Unterlagen und Informationen zu gewähren. Aufgrund der proaktiven Mitwirkung der HSH Nordbank an der Aufklärung ihrer Verstrickungen in Cum-Ex-Geschäfte, entschieden sich sowohl die Hamburger Finanzverwaltung als auch die Hamburg Staatsanwaltschaft eigene Ermittlungen zunächst zurückzustellen. Anfang 2014 schließlich übermittelte CliffordChance ihre Erkenntnisse in Form des s.g. “Saturn-Berichts”. Hieraus ging hervor, dass die Bank rund 112 Millionen Euro Gewinn durch unrechtmäßige Kapitalertragssteuererstattungen aus der Steuerkasse erbeutet hatte. Die Verantwortlichen der HSH übergaben den Bericht der Finanzverwaltung, erklärten sich im Dezember 2013 gegenüber dem Ausschuss für öffentliche Unternehmen der Hamburgischen Bürgerschaft und kündigten an, die illegal erwirtschafteten Gewinne zzgl. Zinsen an die Stadt zurückzuzahlen. Sowohl der SPD-geführte Senat als auch Vertreter*innen der CDU begrüßten dieses Vorgehen damals ausdrücklich. Weitere Untersuchungen seitens Hamburger Finanzverwaltung oder Staatsanwaltschaft im Fall HSH erfolgten anschließend nicht.
Vorwürfe im Fall HSH
Das proaktive Vorgehen bei der Offenlegung ihrer Cum-Ex-Beteiligung und die Mitwirkung der Bank sind (im Unterschied zum Fall Warburg und vielen anderen Cum-Ex-Akteuren bundesweit) positiv hervorzuheben.
Fraglich blieb aber, ob die Untersuchungen der externen Wirtschaftskanzlei tatsächlich unabhängig (Auftrag und Bezahlung der gegen sie gerichteten Untersuchung erfolgte immerhin durch die HSH selbst) und in der Sache als vollständig angesehen werden können. Protokollanmerkungen im Saturn-Bericht deuteten darauf hin, dass der Untersuchungsauftrag der Kanzlei durch die Bank eingeschränkt wurde. Die bisherigen Zeug*innenaussagen konnten die Vorwürfe nicht erhärten – aber auch nicht restlos entkräften. Alle Beteiligten, die bisher angehört wurden, sprachen von einem umfassenden und unabhängigen Mandat für die beauftragte Wirtschaftskanzlei.
Auch war unklar, warum sich sowohl Finanzamt als auch Staatsanwaltschaft anschließend gegen eigenständige Ermittlungen, die über den Saturn-Bericht hinausgingen, entschieden haben. Hierzu verwiesen mehrere Zeug*innen auf den Umfang sowie die akribische Qualität des Saturn-Berichts – andere Zeug*innen machten aber auch deutlich, dass die Möglichkeiten und Befugnisse von staatlichen Ermittlungsbehörden natürlich weit über eine privatwirtschaftliche Untersuchung hinaus gehen (z.B. durch Beweislastumkehr, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen etc.). Aus den bisherigen Beweiserhebungen des PUA bestätigte sich außerdem abermals die strukturellen Defizite innerhalb der Verwaltung, die der PUA bereits in seinem Zwischenbericht hervorhob. So schilderte ein Betriebsprüfer des Finanzamtes eindrücklich, dass er quasi alleine für die komplette Prüfung der damaligen HSH Nordbank zuständig gewesen sei.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Köln die Ermittlungen gegen die ehemalige HSH aufgenommen. Es wird hierbei vor allem darum gehen, ob die Bank in weitere, damals nicht offengelegte Cum-Ex-Geschäfte und darüber hinausgehende steuergetriebene Modelle involviert gewesen ist. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen konnten daran Beteiligte vor dem PUA jedoch keine Auskünfte geben.
Alle bisherigen Zeug*innen verneinten zudem die Frage, ob sie eine politische Einflussnahme im Fall HSH selbst erlebt oder davon gehört hätten.
Ausblick
Mit Ende der aktuellen Wahlperiode, also den Bürgerschaftswahlen im März 2025 wird die Arbeit des Untersuchungsausschusses turnusmäßig enden. Bis dahin wartet noch einige Arbeit auf alle Beteiligten – nicht zuletzt der Abschlussbericht, der alle wesentlichen Feststellungen aus den vergangenen vier Jahren sowie eine Einordnung und Bewertung dieser Tatsachen umfassen wird. Im Unterschied zu einem Strafprozess (an dem die Befugnisse und Kompetenzen eines PUA zwar grundsätzlich orientiert sind, s.o.) fällt ein Untersuchungsausschuss kein Urteil, sondern erstattet der Öffentlichkeit Bericht über die gewonnenen Erkenntnisse. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass die verschiedenen Beteiligten dieser Untersuchung (also die Abgeordneten der unterschiedlichen Fraktionen der Bürgerschaft) auch unterschiedliche Schlüsse aus diesen Erkenntnissen ziehen. Daher umfasst der Abschlussbericht eines PUA so gut wie immer mehrere, sich zum Teil widersprechende Bewertungsabschnitte bzw. s.g. Sondervoten. Dies ist auch beim PUA “Cum-Ex” der Fall.
Wir Grüne setzen uns hier – wie auch schon bei der Bewertung im Zwischenbericht – für einen sachorientierten, faktenbasierten Blick auf die Erkenntnisse ein. Transparenz, Objektivität und effektive Schlussfolgerungen stehen für uns bei derart skandalösen Vorwürfen und einem finanziellen Schaden für die Öffentlichkeit in dreistelliger Millionenhöhe – Geld, das unsere Gesellschaft an anderer Stelle dringend gebraucht hätte – an oberster Stelle.
Der PUA „Cum-Ex“ wird nach Abschluss der Beweisaufnahme deutlich mehr Informationen ermittelt und Zusammenhänge nachvollzogen haben, als Viele ursprünglich erwartet hätten. Dies lag einerseits an der Erweiterung des Untersuchungsauftrags Ende 2022 (Drs. 22/10005), der dadurch neben der Warburg-Bank auch weitere Hamburger Finanzinstitute und deren steuergetriebenenGeschäftstätigkeiten auf dem Kapitalmarkt umfasste. Dies lag andererseits aber auch an der Detailgenauigkeit von Erkenntnissen, die sich über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg aus vielen verlässlichen Quellen zusammenfügten. Dadurch ergab sich speziell im Fall Warburg eine Chronologie der entscheidenden Ereignisse, deren Abläufe (teilweise minütlich) belegbar nachvollzogen werden konnten. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die Arbeit der Staatsanwaltschaft Köln sowie die Recherchen verschiedener Investigativmedien, deren Einsatz auch eine Ode an die Gewaltenteilung ist.
Mit Blick auf die Ergebnisse des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist aber auch klar, dass es weiterhin Fragen gibt, die ungeklärt bleiben (s.o.). Das bedeutet, dass die damit verbundenen Vorwürfe weder belegt noch vollständig entkräftet werden konnten. Diesen Umstand anzuerkennen, gebietet der sachorientierte Blick auf die Faktenlage.
Wir sehen uns auch im Fall HSH in den konkreten Maßnahmen bestätigt, die wir bereits vergangenes Jahr gemeinsam mit unserem Koalitionspartner auf den Weg gebrachten haben und die die strukturelle Stärkung der Finanzverwaltung beim Entdecken und Bekämpfen von Finanzkriminalität erheblich voranbringen. Auch künftig werden wir uns für eine sachorientierte und faktenbasierte Aufklärung von Finanzskandalen wie Cum-Ex einsetzen.
Obmann im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Cum-Ex Steuergeldaffäre:
Sprecher für Medien und Queerpolitik
Farid Müller